Quer durch Deutschland - Route 1.3

| Von Gartz kommend, kann man kurz vor Schwedt von der Umgehungsroute der B2, die sich zwischen dem Zentrum von Schwedt im Osten und der PCK-Raffinerie im Westen dahinschlängelt, links abbiegen und kommt auf der ursprünglichen Trasse der B2 (Chausseestraße) durch Vierraden (Tabakmuseum). Von dort sind es nur noch wenige Kilometer bis zur B166, über die man auch von Süden her das Stadtzentrum von Schwedt erreicht. |
Schwedt/Oder liegt im Nordosten Brandenburgs unmittelbar an der Grenze zu Polen. Einst war die Stadt Residenz der Markgrafen von Brandenburg-Schwedt, einer Seitenlinie der Hohenzollern. Nach holländischem Vorbild angelegt, erhielt die Stadt ein gitterförmiges Straßennetz und barocke Gebäude. Leider hat diese schöne Stadtanlage den Zweiten Weltkrieg nicht unbeschadet überstanden. Nur wenige historische Gebäude sind erhalten geblieben. An der Stelle des früheren Markgrafenschlosses befinden sich die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Der alte Schlosspark bildet in jedem Sommer die malerische Kulisse für die Schlosspark-Festspiele.
Bekannteste Bürgerin ist die Olympiasiegerin Britta Steffen.
Sehenswürdigkeiten:
Fährt man auf der B166 Richtung Osten (Polen), fällt links der Berlischky-Pavillon auf. .
Markgraf Friedrich Heinrich beauftragte 1776 den Baumeister Georg Wilhelm Berlischky mit dem Bau einer Kirche einschließlich einer Gruft. Am 29. August 1777 wurde die Einweihung der Kirche der französisch-refomierten Gemeinde vorgenommen. Sie ist eine der letzten barocken Arbeiten des Schwedter Baumeisters Georg Wilhelm Berlischky und zeigt in Entstehung und Ausführung einige Besonderheiten. Schon ihre ovale Grundrissform weckt das Interesse. Als Vorbild für diesen Zentralbau könnte die Französische Kirche in Potsdam gedient haben. Aus verschiedenen Anregungen heraus schuf Berlischky einen Saalbau, der nicht wie sonst üblich entlang der Ost-West-Achse gerichtet war, sondern parallel zur Hauptachse der ehemaligen Schloßfreiheit steht. Auf vollendet elliptischem Grundriss von 15,50 Meter Länge und 10,80 Meter Breite erhebt sich das in Ziegelbauweise errichtete Sakralgebäude anmutig wie ein besonderer Schmuckstein der Stadt. Der Bau mit seinem hohen Kuppeldach aus Schindeln (nach seiner Erneuerung ist das Dach mit Kupferblech gedeckt) und der kleinen Laterne hat vier gleichmäßig angeordnete Eingänge. Diese geben dem Bau die harmonische Gliederung.
Bei einem Besuch des Kircheninneren wird man von der nicht zu erwartenden Größe überrascht. Die Ausstattung des Innenraumes erfolgte wahrscheinlich in der Zeit von 1777 bis 1785. Im Raumempfinden erkennen wir die Stilrichtung des Rokoko, die Einzelteile der Ausstattung mit ihrer Geradlinigkeit weisen bereits in die Zeit des Klassizismus.
Die Überschrift über dem Haupteingang des Gebäudes könnte Auskunft über den Beweggrund zur Errichtung der Kirche gegen. Sie lautet frei übersetzt: „Diese Kirche ist Gott, dem Allgütigen und Allerhöchsten infolge eines Gelübdes gewidmet von Friedrich Heinrich, Prinz von Preußen, Markgraf von Brandenburg 1777.“
Die Kirche war Erbbegräbnis der Schwedter Markgrafen. Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die Särge der Hohenzollernangehörigen in den Berliner Dom umgebettet.
Bis 1908 diente die Kirche als Gotteshaus der französisch-reformierten Gemeinde und als Grabkapelle der markgräflichen Familie. Danach stand das baukünstlerische Kleinod leer und verfiel. Schließlich wurde es als Gedächtnishalle für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges instandgesetzt und 1925 von Wilhelm II. der Stadt übergeben.
Im Zweiten Weltkrieg weitestgehend verschont, diente der Bau bis 1976 der französisch-reformierten Kirchengemeinde in Schwedt zum Gottesdienst.
1984 erfolgte eine grundlegende Erneuerung, bei der unter Beachtung aller denkmalpflegerischen Aspekte der ursprüngliche Bau erhalten blieb. Seither trägt das Bauwerk den Namen „Berlischky-Pavillon“. Der Pavillon wird für Veranstaltungen durch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, für Konzerte der Musik- und Kunstschule sowie als Standesamt genutzt.
Kurz davor führt rechts die Bahnhofstraße ins Zentrum. Als erstes fällt dort das Amtsgericht auf, ein neugotischer Ziegelbau aus dem Jahr 1898.. Gegenüber steht die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt, ebenfalls ein Backsteinbau aus dem Jahr 1898.
Die evangelische Stadtpfarrkirche St. Katharinen ist ein großer, kreuzförmig angelegter Feldsteinbau aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, 1887–1889 erneuert. Diese Kirche ist das älteste erhaltene Bauwerk im Stadtgebiet. Der Turm wurde jedoch erst 1705 vollendet. Am 18. April 1945 brannte die Kirche ab. Die gesamte wertvolle Innenausstattung wurde vernichtet.
Der Juliusturm am Bollwerk wurde um 1909 im Zuge der Errichtung einer Abwasserkanalisation in Anlehnung an die Spandauer Zitadelle gebaut. Das Pumpwerk wurde mit einer „Borsigschen Mammutpumpe“ bestückt, die nach damaligem Stand der Technik als beste Fördereinrichtung für Abwasser galt. Der achteckige Turm, in dem noch heute alle Abwässer der Innenstadt gesammelt werden, ist nicht nur das erste Klärwerk der Stadt, sondern auch eines der ungewöhnlichsten in ganz Brandenburg.
| Die neue Streckenführung der B2 ab Sommer 2006 führt nördlich aus Schwedt, um dann im großen Bogen zwischen Felchow und Dobberzin die alte Straßenführung wieder zu erreichen. Vor diesem Neubau führte die B 2 durch die Orte Meyenburg, Flemsdorf und Felchow. Heute firmiert dieser Abschnitt als L284. |

Schwedt, Berlischky-Pavillon (1777)
Beiträge
können Sie senden an: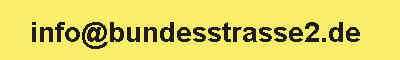 |